Teil 1 – Eine Fortsetzungsgeschichte aus dem Nordschwarzwald.
Wir schreiben das Jahr 1946, gegen 10 Uhr, ich war noch nicht 7 Jahre alt. Mein Bruder Bernhard, ein Erfindergeist, war 14 Jahre. Eine Erinnerung aus den Kriegstagen gibt folgende Geschichte wieder.
Am 10. September 1944 zerstörten Bombenangriffe meine Geburtsstadt Gaggenau, damals wie heute eine moderne Industriestadt, wo Unternehmergeist den Entwicklungsfortschritt signalisiert. Der Krieg veränderte nicht nur in eklatanter wie katastrophaler Weise das Gesicht dieser Stadt, sondern nahm den Stadtbewohnern die Lebensgrundlage. In wenigen Minuten wurde durch die Zerstörungswut alliierter Bomberverbände die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Die Kriegsereignisse und ihre Folgen ließen viele der Überlebenden vom gemeinschaftlichen städtischen Miteinander zum exorbitanten Überlebenskampf mutieren. In fataler Weise betraf das auch unsere siebenköpfige Familie, die alles Hab und Gut verloren hatte.
Nach dem Fliegerinferno evakuierten wir in ein Nordschwarzwalddorf, das den alten kulturellen, archaischen Lebensstil unverrückbar dokumentierte. Dort in dieser Fremdheit fanden wir im Armenhaus eine Bleibe.
Das Armenhaus war auf einer sehr steilen Erhöhung gelegen. Ringsherum Steilhänge mit abfallenden Feldern und Wiesen. In der Talsohle ein Bachlauf. Sein Interieur, in der Mitte eine Kochnische mit einem veralteten Herd, links und rechts davon je ein gleichgroßes Zimmer in sehr dürftigem Zustande – eben Armenhaus. Dieses Armenhaus hatte, wenn man die Stallung im felsigen Fundament nicht dazu zählt, drei Türen, die allen Kreaturen, die in dem Armenhaus ihre Behausung reklamierten, offen stand. Wir waren Eindringlinge. Fünf Fenster in sehr luftiger Beschaffenheit. In der Küche stand, wie gesagt, ein Herd. Ein Zimmer wurde mit einem kleinen gusseisernen Kanonenofen geheizt. So hausten und vegetierten wir in plötzlich hereingebrochener Armut und Not. Dies auch in winterlicher Atmosphäre, wo große Eisblumen nicht nur die mangelbehafteten Fenster, sondern auch die nur 12 cm dicken Backsteinwände, welche das hölzerne Fachwerk unseres Armenhauses füllten, schwungvoll, künstlerisch überzogen. Mit den düsteren, bedrückenden, kargen und durch Not, Elend und Armut gekennzeichneten Lebensumständen wurde das Überleben von essenzieller Bedeutung. Es war unerträglich, in dem Gesicht meiner Mutter das Entsetzen zu lesen, was Krieg über den Menschen ausschüttet. In wenigen Worten hörte ich sie immer wieder sagen, ohne die Tiefe der seelischen Zerrissenheit als Kind ergründen zu können, „die Barbarei des Krieges“. Durch die Zerstörungswut der kriegerischen Handlungen entstand für jeden der unmittelbar Betroffenen eine Tyrannei des Überlebens. Heute sage ich: „Der Supergau in einer Familie“. Doch die Not, das Elend und der Hunger machten erfinderisch. Das Armenhaus, wie schon angedeutet, auf einem Hügel, nicht weit weg von einem Gebirgsbach gelegen, vermittelte von außen, in der Distanz betrachtet, zu allen Jahreszeiten eine Postkartenidylle. Von Franz Lehar gibt es die Operette „Das Land des Lächelns“; man nennt sie auch eine romantische Operette mit der Liedpassage des Sou Chong: „Immer nur lächeln…….. und wie‘s darinnen aussieht geht niemand was an.“ Solche Zurückhaltung war erforderlich, um die Verzweiflung nicht zum lähmenden Lebenselement werden zu lassen.
Solche Eindrücke bewegten auch uns Kinder, auf abenteuerliche Entdeckungserkundigungen zu gehen. Dabei mussten wir den Anweisungen meiner lieben Mutter folgen, Vater war noch in englischer Gefangenschaft, sich nicht all zu weit vom Hause zu entfernen. Die Lebensgewohnheiten des Dorfes mussten zunächst erfahren werden. Nicht nur für meine Mutter, sondern auch für uns fünf Kinder. Vor allem mein Bruder Bernhard, mit seinem nicht ruhenden Forscherdrang und seiner Neugierde, die sich in seltsamen Experimenten erschöpfte, war eine unkalkulierbare Herausforderung, das Risiko, das meine Mutter erkannte und aushalten musste. Seine Forschungskraft schöpfte er aus den Ideen, um die Zukunft zu gestalten. Der Gefahrengrad durch die Besatzermentalität, der herumliegenden Munition – Blindgänger (Granaten, Tellerminen, Sprengmimen – bis hin zu nicht explodierten Brandbomben) war nicht zu unterschätzen. Mit Sicherheit konnte meine Mutter weder die geografische Lage des Armenhauses, noch den Umgang mit den Gemeindemitgliedern ganz einschätzen. Es gab wichtigere Dinge zu bewältigen, z. B. das Vertreiben der vierfüßigen, neugierigen, pelzigen Mitbewohner, Käfer aus Urzeiten und auf der Lauer liegenden Spinnen. Besonders am Abend, wenn die Tierchen sich auf Nahrungswanderschaft begaben, dabei erkundschafteten, wer da so als Fremdling zu hausen begann, war meine Mutter zu Wachsamkeit genötigt. Oder das Sammeln von Holz, das Strukturieren und Organisieren von Nahrung, denn ein harter Winter stand vor der Tür, und er kam mit eisiger Kälte.
Neu und verwunderlich für uns Stadtbewohner war, dass es in diesem Dorf einen Nachrichtengeber gab, der durch das Dorf zog und an auserwählten Straßen – Häuserpositionen seine Stellung einnahm und die Bewohner mit einer Schelle durch kräftiges Schütteln zur Aufmerksamkeit rief. So auch uns. Als wir das Ausschellen hörten, ohne eine Ahnung zu haben, was es bedeutet, gingen wir vor die Tür und erblickten zwischen dem Armenhause und einem links stehenden Schwarzwaldhaus auf der Straßenecke eine Person in bäuerlicher Fasson, der dann verkündete, was er zu verkünden hatte. Der Gemeindeverkünder oder Dorfnachrichtengeber, vielleicht auch zum Volkstribun erkorener, sprach im Wortschwall, nein in der Schnelle aufeinander folgender Töne an die Dorfgemeinschaft die Parole aus, auf Veranlassung der französischen Besatzer, seine Pandora scheint gefüllt zu sein, mit zu verkündeten Verhaltensanweisungen, dass diejenigen, welche die Auflassung – Mahnung nicht befolgten, mit bedrohlichen Konsequenzen, bis zur standesrechtlichen Erschießung zu rechnen haben. Ein Befehl war der, aufgrund der bekannten und sprichwörtlichen Angelleidenschaft der Franzosen, dass es nicht erlaubt sei, den Gebirgsbach nach Fischen zu bejagen, in welcher Weise auch immer, oder überhaupt Jagd auszuüben. Die kulturellen und geistigen Verhältnisse zwischen den Besatzern und den Einheimischen waren doch verändert nivelliert, dass die Kreativität der Einheimischen dem Halali nicht entsagen mussten. Der Schwarzwald hat nicht umsonst diesen farblichen Charakter.
Ein sehr kalter, eisiger schneereicher Winter ging zu Ende. Es erinnerte dann an das Epos von J.W. v. Goethe „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick, im Tale grünet Hoffnungsglück“ was mein Vater nach seiner Entlassung aus der britischen Gefangenschaft 1945 zu rezitieren vermochte.
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick, im Tale grünet Hoffnungsglück.
J.W. v. Goethe
Meine lieben Eltern waren in dieser zermürbenden, von Elend gepflasterten Zeitepoche im Ausdruck von Melancholie befähigt, Kopf und Herz im Gleichgewicht zu halten, damit angeregt ist, das Hoffnungsvolle für die Zukunft in der Familie zu gestalten. Eines Tages kann unsere Mutter mit fast leeren Händen von einer Hamsterreise zurück. Die Taschen waren leer. Die Beschwerlichkeit war ihr ins Gesicht geschrieben. Bevor Sie aber das Armenhaus betrat, hatte Sie noch eine rein zufällige Begegnung, einen Wortwechsel mit einer gealterten Bäuerin. Mutter reagierte auf eine Information und eilte den Straßenbuckel nach unten. Mit dem Ausruf: „ich komme gleich wieder zurück“ steuerte sie einen Tante-Emma-Laden an. Mutter versuchte, unter Vorlage des Zuwendungsscheins (Lebensmittecoupon) in einen dafür bestimmten Laden zu gehen. Es gab nur zwei Kolonialwarenläden in diesem Bergdorf. Nur ein Laden davon war befugt, solche Lebensmittelmarken in Tausch zu nehmen. Mutti sagte gegenüber der Verkäuferin hinter der Theke, dass durch einen Aufruf durch den Dorfschreier bekundet wurde, dass es Salzheringe auf Marken geben würde. Diese Information hatte Mutti nicht selbst vernommen, sie war ja auf Hamsterreise. Aber die sehr gütige, gealterte Frau, die wir Kinder in der Anrede zur Großmutter getauft hatten, obwohl sie es schon vielfach war, gebeugt von der Last der harten Arbeit, im Verständnis ihres Glaubensbildes der Nächstenliebe sehr verpflichtend zugewandt, begegnete Mutti vor Eintritt ins Armenhaus und setzte sie in Kenntnis, dass der Dorfausrufer, der Schellenmann bekannt machte, dass Salzheringe zum Verkauf angeboten wurden. Die Dame hinter der Theke antwortete sehr wohlwollend, es gibt Salzheringe aus dem Fass, und wenn sie möchte, könnte sie für jedes Familienmitglied („wir sind sieben“ sagte Mutti), jeweils einen Salzhering haben. Die Verkaufsdame rückte von den stinkenden, bräunlich in Salzlake erstarren Fischen 7 Stück in ein Packpapier und übergab das Bündel. Die fälligen Lebensmittelkartenabschnitte wurden mittels einer Schere abgetrennt. Gesagt getan und Mutter kam mit diesen penetrant riechenden Meerjungfrauen, so möchte ich das heute benennen, nach Hause.
Um die Errungenschaft dem Gaumen zuzumuten, waren gezielte Handgriffe erforderlich. Mein Vater, der die Gefangenschaft sehr kurzfristig hinter sich gebracht hatte, assistierte in hilfreicher, zuverlässiger Absicht. Zunächst eine Schüssel. Dann das kontrollierte Hineinlegen der unansehnlichen, salzstarren Fischkörper. Dann das fließende Wasser aus einem immer tropfenden Wasserhahn, das über die in einer Schüssel liegenden, auf Tauchstation befindlichen Fische der Reinigung ausgesetzt sind, damit die im Fisch penetrierte Salzlake durch stetiges Wasserspülen herausgewaschen wird. Da meine lieben Eltern der französischen Küche angenehm zugetan waren, was vor allem die Lebensweise, die Kochkunst betraf, konnte mit den stromlinienförmigen, zunächst unappetitlichen Kreaturen, wohl schmeckendes zubereitet werden. Wir konnten verwundert beobachten, wie die Einkäufe der unappetitlich wirkenden Salzheringe, wenn von den Einheimischen solche getätigt worden sind, aufgrund von Nichtwissen der Zubereitung, auf dem Misthaufen landeten. Das Nahrhafte aus eigener bäuerlicher Produktion hat immer den Vorzug erhalten. Somit kam uns diese Zurückhaltung entgegen, bis zur Neige des Fasses.
 Rezeptur und Zutaten für eingelegte Salzheringe
Rezeptur und Zutaten für eingelegte Salzheringe
In den Kriegstagen mit selbst gebackenem Maisbrot.
8 Stück Salzheringe, gut gewässert, bis ein nicht auffälliger, fein sich auf der Zunge anfühlender Salzgeschmack auf dem Hering noch vorhanden ist.
Salzheringe mit Gräten in 3 cm große Stücke schneiden.
3 mittelgroße Zwiebeln in dünne ca. 1,5 mm Scheiben schneiden.
3 Knoblauchzehen sehr fein zerhacken.
2 Äpfel in kleine Würfel schneiden.
10 selbst eingemachte Essiggurken in dünne ca. 2mm dicke Scheiben schneiden.
Eine erlesene Buttermilch, vielleicht 1 Liter, damit die Fische gut überdeckt sind.
Etwas frische Sahne, sauer besser als süß.
Etwas Cayennepfeffer, weiße und schwarze Pfefferkörner und vielleicht auch noch etwas Salz zum Abschmecken, nur wenn erforderlich.
Ein Gedanke zur Großmutter. Die Großmutter hat uns die Sahne zukommen lassen, manchmal unter ihrer großen Schürze verborgen. Großmutter wollte sich verständlicherweise keinem egoistischen Blick in dieser Notzeit aussetzen und war dabei sehr erfinderisch. Und nicht nur was die Sahne betraf. Da gab es für uns Kinder ein Stück selbst gebackenes Brot, mal selbst gemachten Quark, eine Blutwurst oder für Mutter ein Stück Speck oder eine kräftige Scheibe Butter, etwas Milch, Buttermilch, Kartoffeln und, und, und. Und einmal im Jahr wurde der selbstgemauerte Ofen mit flammenden Reisigbündeln auf Temperatur gebracht, um Birnen- und Apfelschnitze zu dörren. Da wir fünf Kinder uns als sehr wendig und gehorsam gezeigt haben, hat uns die Großmutter dazu berufen, nachdem der Trockenbackofen nach zwei Tagen erkaltet war, das gedörrte Obst einzuholen, was wir natürlich mit hungrigen Magen und Freude taten. Danach wurden wir mit einem Korb Dörrobst entlohnt, den wir mit glücklichem Empfinden nach Hause gebracht haben. Großmutter war in ihrer Güte und Nächstenliebe die Inkarnation.
Cayennepfeffer Anekdote 1920
Zum Cayennepfeffer die folgende Anekdote, die erwähnenswert ist.
Meine Mutter hat immer versucht, die Gewürze so über die Zeit aufzubereiten, dass diese Ingredienzien fast durch alle Jahreszeiten zur Verfügung standen. Nun hatten wir nach dem Bombardement alles, aber auch alles verloren, außer dem, was die Kellerflucht zum Lebensschutz am Leibe übrig gelassen hat. Das bedeutete auch all die getrockneten, eingeweckten, über den Winter verfügbar gemachten Naturprodukte.
Meine liebe Tante Frieda aus Karlsruhe Durlach, die in den 20er Jahren als Hausdame in einer sehr noblen holländischen Familie beheimatet war, kam über die Zeit ihrer Anstellung bis zu ihrem Ausscheiden im Jahre 1940, so meine ich, mit internationalen Gewürzen in Verbindung. Diese von Tante Frieda sehr geachteten Persönlichkeiten beschenkten sie mit Gewürzen aller Art, insbesondere aus den asiatischen Ländern mit dem Hinweis, sie möge diese Gewürze an ihre Eltern als etwas Erlesenes, als ein Geschenk weiterreichen. Meine Großeltern konnten nicht viel damit anfangen, zumal der Gaumen geschmacklich nach den heimischen Gewürzzutaten ausgerichtet war. Tante Frieda hatte aber das Wissen um die geschmackserweiternden Kostbarkeiten dieser Gewürze in einem wunderschönen Schrank gespeichert, ja gehortet, weil meine Großeltern väterlicherseits selbst gewohnt waren, Speisen mit den Aromaten aus anderen Ländern zu verfeinern. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, meine Mutter hat mich in meiner Knabenzeit in das elterliche Haus zu meinen Großeltern nach Durlach gebracht. Es was zur damaligen Zeit für mich ein abenteuerliches, mit Neugierde erfülltes Vergnügen. Mutti wollte mal wieder schauen, was zurückgelassen wurde. Kaum war ich in der Wohnung in der Küche angekommen, fragte mich Tante Frieda, ob ich eine Tasse Kakao wolle. Ich stutzte und schaute verwundert meine Mutter an, weil ich mit dem Begriff Kakao nichts zu deuten wusste. Mutti sagte lediglich: „Ja, der Kleine soll das mal trinken“. Tante Frieda begab sich an einen Küchenschrank aus Mahagoniholz. Im Inneren wie ein Apothekerschrank mit vielen kleinen Schubladen. Außen eher klassizistisch, vielleicht auch Empire. Als die Schranktüren mit bunten, in Blei gefassten Glasscheiben geöffnet wurden, überwältigte mich eine Duftkombination von Aromen, die mich bis zum heutigen Tage faszinieren und fesseln. So lange ich die Möglichkeit hatte, nämlich bis 1971, als Tante Frieda sich entschloss, im Hause meiner Eltern ihren Lebensabend zu verbringen, reiste ich nach Durlach, um den Duft aus dem Schrank der Tante zu konservieren. So war es auch gegeben, dass die Vielzahl der aus den 20er Jahren stammenden Gewürze nach dem Kriege 1945 das Karge zum Besseren ermöglichten. So auch durch den Cayennepfeffer.
Günther de Temple
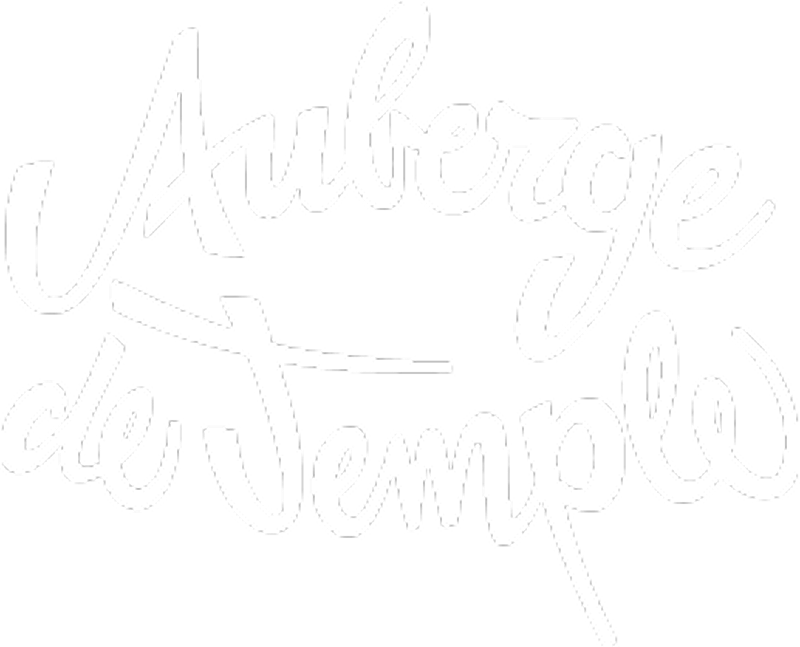




Isabel