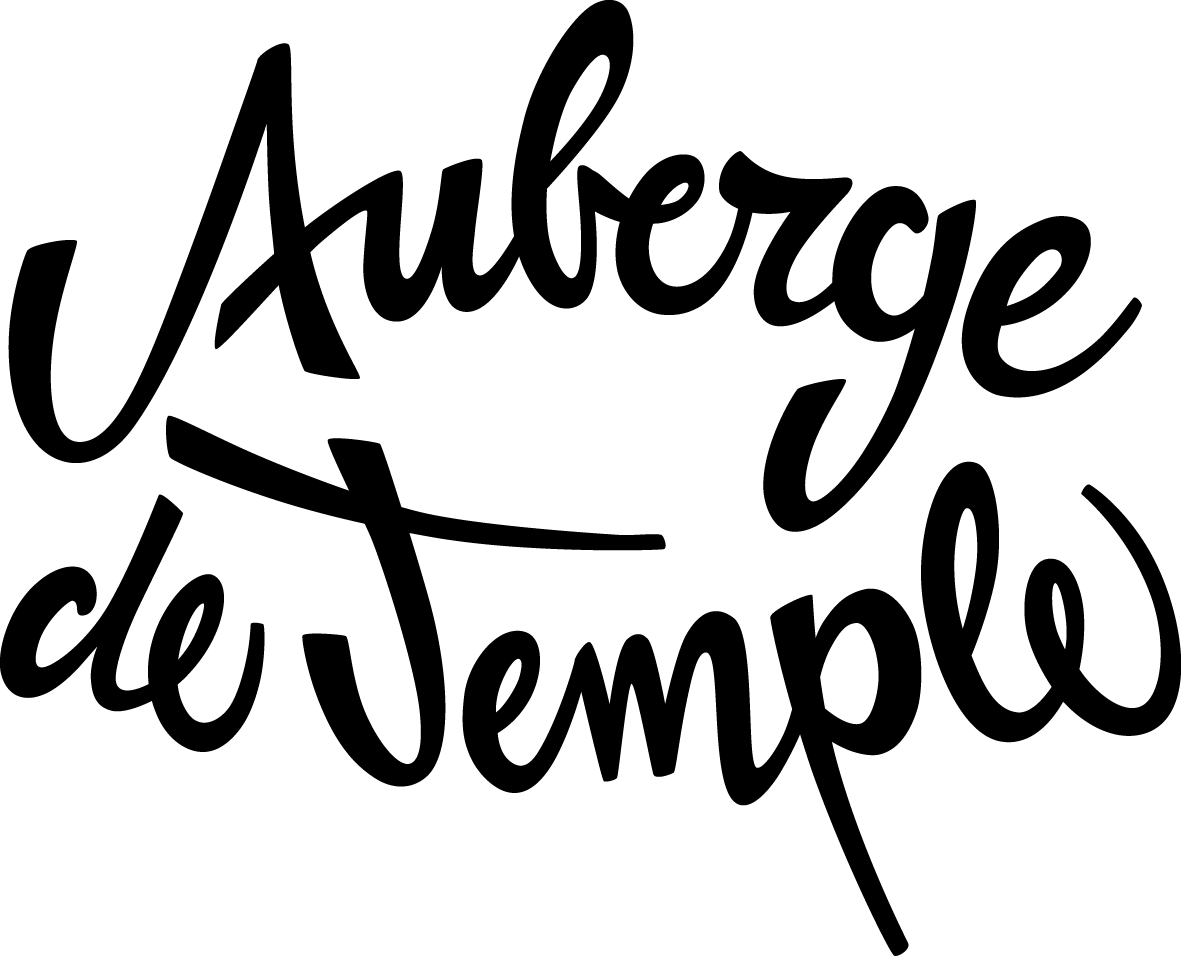Auberge de Temple
Ein Haus mit Seele und Geschichte bereitet sich auf ein neues Kapitel vor, das höchsten kulinarischen Anspruch, inspirierende Kunst und außergewöhnliche Begegnungen verbindet.
Bevor sich die Türen bald wieder öffnen, werden die Räume mit Respekt vor seiner Geschichte renoviert und vorbereitet.
Während wir hinter den Türen arbeiten, entstehen neue Gedanken, Pläne und Ideen.